2014 Seat Mii electric ABS
[x] Cancel search: ABSPage 157 of 229
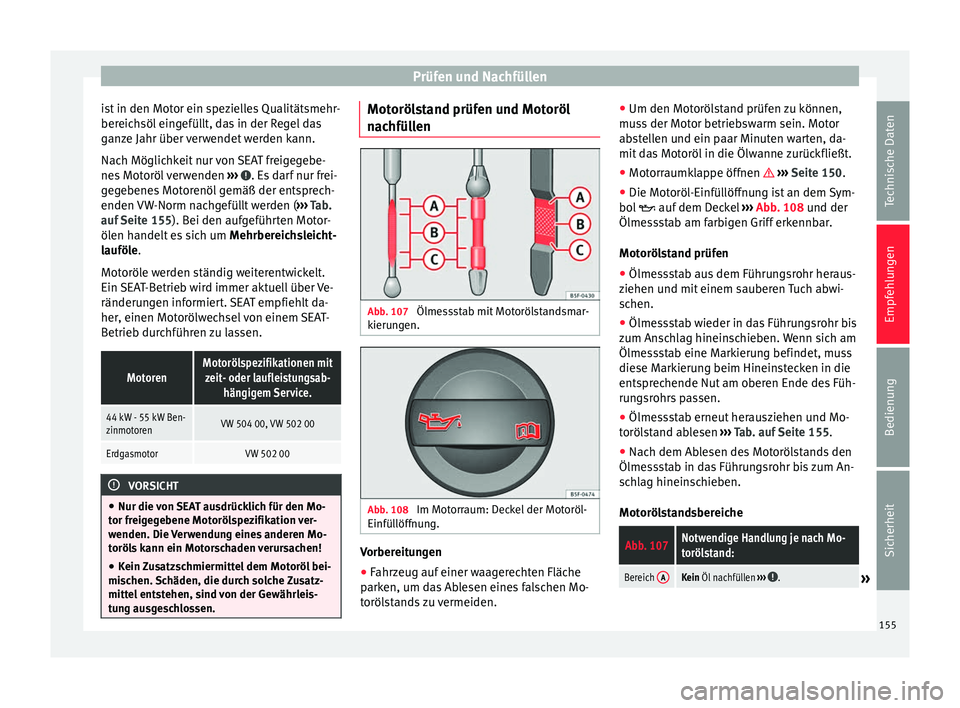
Prüfen und Nachfüllen
ist in den Motor ein spezielles Qualitätsmehr-
bereichsöl eingefüllt, das in der Regel das
ganze Jahr über verwendet werden kann.
Nach Möglichkeit nur von SEAT freigegebe-
nes Motoröl verwenden ››› . Es darf nur frei-
gegebenes Motorenöl gemäß der entsprech-
enden VW-Norm nachgefüllt werden ( ››› Tab.
auf Seite 155 ). Bei den aufgeführten Motor-
öl en h
andelt es sich um Mehrbereichsleicht-
lauföle
.
Motoröle werden ständig weiterentwickelt.
Ein SEAT-Betrieb wird immer aktuell über Ve-
ränderungen informiert. SEAT empfiehlt da-
her, einen Motorölwechsel von einem SEAT-
Betrieb durchführen zu lassen.
MotorenMotorölspezifikationen mit zeit- oder laufleistungsab- hängigem Service.
44 kW - 55 kW Ben-
zinmotorenVW 504 00, VW 502 00
ErdgasmotorVW 502 00 VORSICHT
● Nur die von SEAT ausdrücklich für den Mo-
tor freigegebene Motorölspezifikation ver-
wenden. Die Verwendung eines anderen Mo-
toröls kann ein Motorschaden verursachen!
● Kein Zusatzschmiermittel dem Motoröl bei-
mischen. Schäden, die durch solche Zusatz-
mittel entstehen, sind von der Gewährleis-
tung ausgeschlossen. Motorölstand prüfen und Motoröl
nachfüllen
Abb. 107
Ölmessstab mit Motorölstandsmar-
kierungen. Abb. 108
Im Motorraum: Deckel der Motoröl-
Einfüllöffnung. Vorbereitungen
●
Fahrzeug auf einer waagerechten Fläche
parken, um das Ablesen eines falschen Mo-
torölstands zu vermeiden. ●
Um den Motorölstand prüfen zu können,
muss der Motor betriebswarm sein. Motor
abstellen und ein paar Minuten warten, da-
mit das Motoröl in die Ölwanne zurückfließt.
● Motorraumklappe öffnen
›
›› Seit
e 150.
● Die Motoröl-Einfüllöffnung ist an dem Sym-
bol
auf dem Deckel ››› Abb. 108 und der
Ölmes
sstab am farbigen Griff erkennbar.
Motorölstand prüfen
● Ölmessstab aus dem Führungsrohr heraus-
ziehen und mit einem sauberen Tuch abwi-
schen.
● Ölmessstab wieder in das Führungsrohr bis
zum Anschlag hineinschieben. Wenn sich am
Ölmessstab eine Markierung befindet, muss
diese Markierung beim Hineinstecken in die
entsprechende Nut am oberen Ende des Füh-
rungsrohrs passen.
● Ölmessstab erneut herausziehen und Mo-
torölstand ablesen ››› Tab. auf Seite 155.
● Nach dem Ablesen des Motorölstands den
Ölmessstab in das Führungsrohr bis zum An-
schlag hineinschieben.
Motorölstandsbereiche
Abb. 107Notwendige Handlung je nach Mo-
torölstand:
Bereich AKein Öl nachfüllen
››› .» 155
Technische Daten
Empfehlungen
Bedienung
Sicherheit
Page 158 of 229
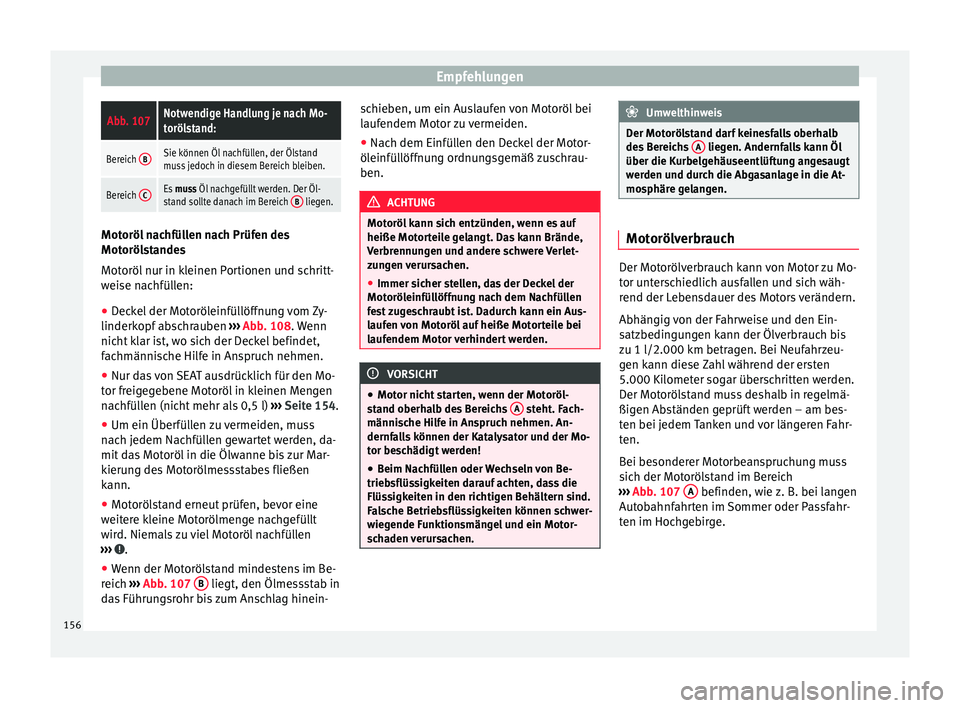
EmpfehlungenAbb. 107Notwendige Handlung je nach Mo-
torölstand:
Bereich
BSie können Öl nachfüllen, der Ölstand
muss jedoch in diesem Bereich bleiben.
Bereich CEs
muss Öl nachgefüllt werden. Der Öl-
stand sollte danach im Bereich B liegen.Motoröl nachfüllen nach Prüfen des
Motorölstandes
Motoröl nur in kleinen Portionen und schritt-
weise nachfüllen:
● Deckel der Motoröleinfüllöffnung vom Zy-
linderkopf abschrauben ›››
Abb. 108 . Wenn
nic ht
klar ist, wo sich der Deckel befindet,
fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
● Nur das von SEAT ausdrücklich für den Mo-
tor freigegebene Motoröl in kleinen Mengen
nachfüllen (nicht mehr als 0,5 l) ›››
Seite 154.
● Um ein Überfül
len zu vermeiden, muss
nach jedem Nachfüllen gewartet werden, da-
mit das Motoröl in die Ölwanne bis zur Mar-
kierung des Motorölmessstabes fließen
kann.
● Motorölstand erneut prüfen, bevor eine
weitere kleine Motorölmenge nachgefüllt
wird. Niemals zu viel Motoröl nachfüllen
››› .
● Wenn der Motorölstand mindestens im Be-
reich ›››
Abb. 107 B liegt, den Ölmessstab in
das Führungsrohr bis zum Anschlag hinein- schieben, um ein Auslaufen von Motoröl bei
laufendem Motor zu vermeiden.
●
Nach dem Einfüllen den Deckel der Motor-
öleinfüllöffnung ordnungsgemäß zuschrau-
ben. ACHTUNG
Motoröl kann sich entzünden, wenn es auf
heiße Motorteile gelangt. Das kann Brände,
Verbrennungen und andere schwere Verlet-
zungen verursachen.
● Immer sicher stellen, das der Deckel der
Motoröleinfüllöffnung nach dem Nachfüllen
fest zugeschraubt ist. Dadurch kann ein Aus-
laufen von Motoröl auf heiße Motorteile bei
laufendem Motor verhindert werden. VORSICHT
● Motor nicht starten, wenn der Motoröl-
stand oberhalb des Bereichs A steht. Fach-
männische Hilfe in Anspruch nehmen. An-
dernfalls können der Katalysator und der Mo-
tor beschädigt werden!
● Beim Nachfüllen oder Wechseln von Be-
triebsflüssigkeiten darauf achten, dass die
Flüssigkeiten in den richtigen Behältern sind.
Falsche Betriebsflüssigkeiten können schwer-
wiegende Funktionsmängel und ein Motor-
schaden verursachen. Umwelthinweis
Der Motorölstand darf keinesfalls oberhalb
des Bereichs A liegen. Andernfalls kann Öl
über die Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt
werden und durch die Abgasanlage in die At-
mosphäre gelangen. Motorölverbrauch
Der Motorölverbrauch kann von Motor zu Mo-
tor unterschiedlich ausfallen und sich wäh-
rend der Lebensdauer des Motors verändern.
Abhängig von der Fahrweise und den Ein-
satzbedingungen kann der Ölverbrauch bis
zu 1 l/2.000 km betragen. Bei Neufahrzeu-
gen kann diese Zahl während der ersten
5.000 Kilometer sogar überschritten werden.
Der Motorölstand muss deshalb in regelmä-
ßigen Abständen geprüft werden – am bes-
ten bei jedem Tanken und vor längeren Fahr-
ten.
Bei besonderer Motorbeanspruchung muss
sich der Motorölstand im Bereich
››› Abb. 107 A befinden, wie z. B. bei langen
Autobahnfahrten im Sommer oder Passfahr-
ten im Hochgebirge.
156
Page 160 of 229
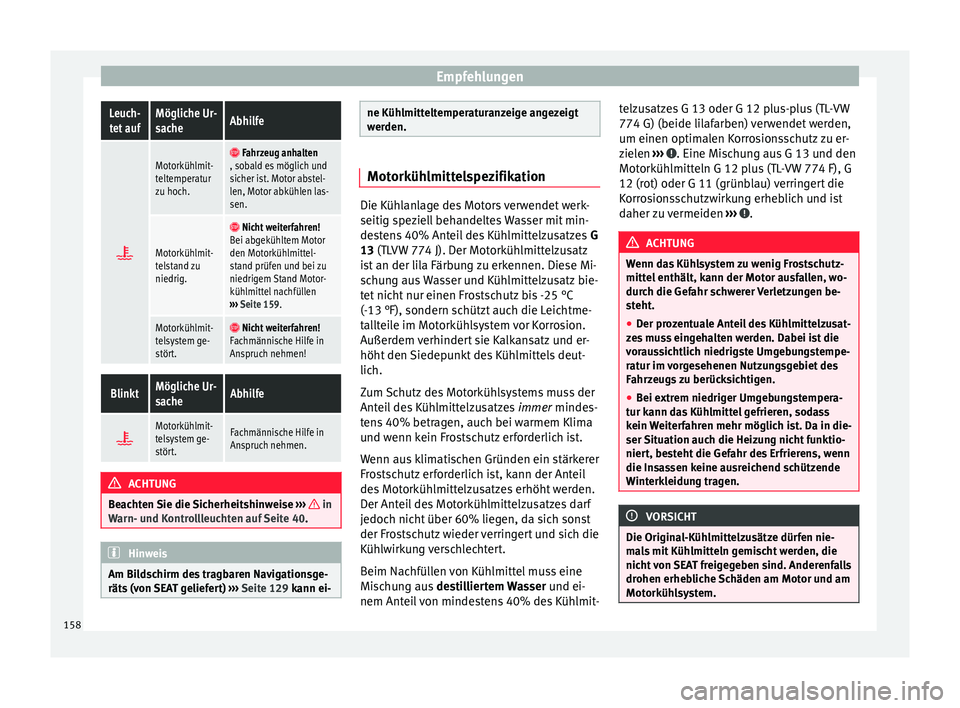
EmpfehlungenLeuch-
tet aufMögliche Ur-
sacheAbhilfe
Motorkühlmit-
teltemperatur
zu hoch. Fahrzeug anhalten
, sobald es möglich und
sicher ist. Motor abstel-
len, Motor abkühlen las-
sen.
Motorkühlmit-
telstand zu
niedrig.
Nicht weiterfahren!
Bei abgekühltem Motor
den Motorkühlmittel-
stand prüfen und bei zu
niedrigem Stand Motor-
kühlmittel nachfüllen
››› Seite 159.
Motorkühlmit-
telsystem ge-
stört. Nicht weiterfahren!
Fachmännische Hilfe in
Anspruch nehmen!
BlinktMögliche Ur-
sacheAbhilfe
Motorkühlmit-
telsystem ge-
stört.Fachmännische Hilfe in
Anspruch nehmen.
ACHTUNG
Beachten Sie die Sicherheitshinweise ››› in
Warn- und Kontrollleuchten auf Seite 40. Hinweis
Am Bildschirm des tragbaren Navigationsge-
räts (von SEAT geliefert) ››› Seite 129 kann ei- ne Kühlmitteltemperaturanzeige angezeigt
werden.
Motorkühlmittelspezifikation
Die Kühlanlage des Motors verwendet werk-
seitig speziell behandeltes Wasser mit min-
destens 40% Anteil des Kühlmittelzusatzes
G
13 (TLVW 774 J). Der Motorkühlmittelzusatz
i s
t an der lila Färbung zu erkennen. Diese Mi-
schung aus Wasser und Kühlmittelzusatz bie-
tet nicht nur einen Frostschutz bis -25 °C
(-13 °F), sondern schützt auch die Leichtme-
tallteile im Motorkühlsystem vor Korrosion.
Außerdem verhindert sie Kalkansatz und er-
höht den Siedepunkt des Kühlmittels deut-
lich.
Zum Schutz des Motorkühlsystems muss der
Anteil des Kühlmittelzusatzes immer mindes-
t en
s 40% betragen, auch bei warmem Klima
und wenn kein Frostschutz erforderlich ist.
Wenn aus klimatischen Gründen ein stärkerer
Frostschutz erforderlich ist, kann der Anteil
des Motorkühlmittelzusatzes erhöht werden.
Der Anteil des Motorkühlmittelzusatzes darf
jedoch nicht über 60% liegen, da sich sonst
der Frostschutz wieder verringert und sich die
Kühlwirkung verschlechtert.
Beim Nachfüllen von Kühlmittel muss eine
Mischung aus destilliertem Wasser und ei-
nem Anteil von mindestens 40% des Kühlmit- telzusatzes G 13 oder G 12 plus-plus (TL-VW
774 G) (beide lilafarben) verwendet werden,
um einen optimalen Korrosionsschutz zu er-
zielen
››› . Eine Mischung aus G 13 und den
Motorkühlmitteln G 12 plus (TL-VW 774 F), G
12 (rot) oder G 11 (grünblau) verringert die
Korrosionsschutzwirkung erheblich und ist
daher zu vermeiden ››› .
ACHTUNG
Wenn das Kühlsystem zu wenig Frostschutz-
mittel enthält, kann der Motor ausfallen, wo-
durch die Gefahr schwerer Verletzungen be-
steht.
● Der prozentuale Anteil des Kühlmittelzusat-
zes muss eingehalten werden. Dabei ist die
voraussichtlich niedrigste Umgebungstempe-
ratur im vorgesehenen Nutzungsgebiet des
Fahrzeugs zu berücksichtigen.
● Bei extrem niedriger Umgebungstempera-
tur kann das Kühlmittel gefrieren, sodass
kein Weiterfahren mehr möglich ist. Da in die-
ser Situation auch die Heizung nicht funktio-
niert, besteht die Gefahr des Erfrierens, wenn
die Insassen keine ausreichend schützende
Winterkleidung tragen. VORSICHT
Die Original-Kühlmittelzusätze dürfen nie-
mals mit Kühlmitteln gemischt werden, die
nicht von SEAT freigegeben sind. Anderenfalls
drohen erhebliche Schäden am Motor und am
Motorkühlsystem. 158
Page 161 of 229
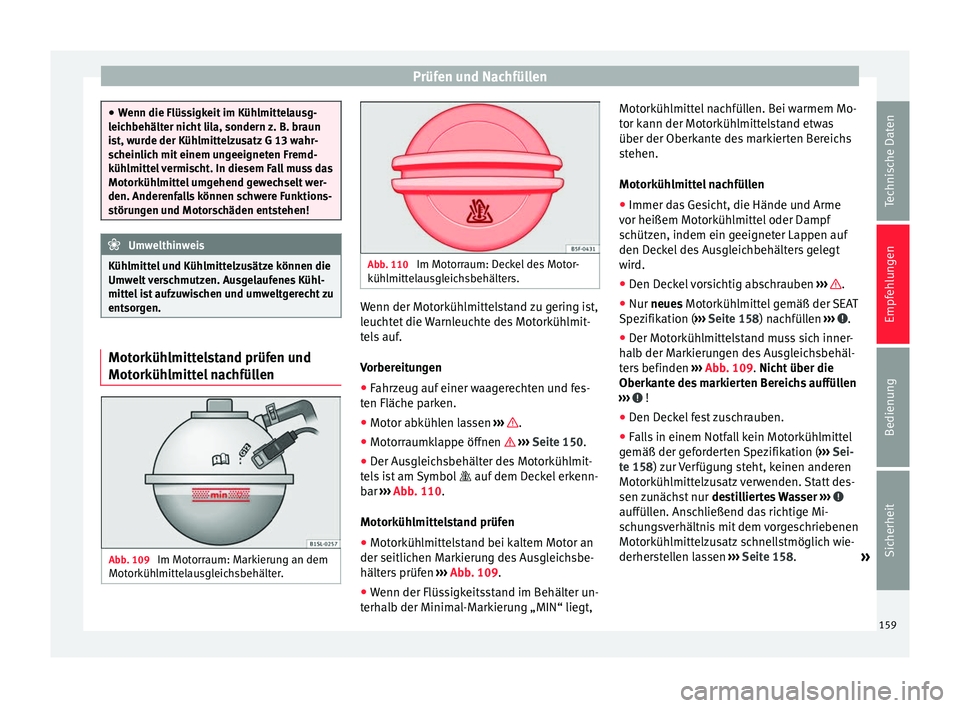
Prüfen und Nachfüllen
●
Wenn die Flüssigkeit im Kühlmittelausg-
leichbehälter nicht lila, sondern z. B. braun
ist, wurde der Kühlmittelzusatz G 13 wahr-
scheinlich mit einem ungeeigneten Fremd-
kühlmittel vermischt. In diesem Fall muss das
Motorkühlmittel umgehend gewechselt wer-
den. Anderenfalls können schwere Funktions-
störungen und Motorschäden entstehen! Umwelthinweis
Kühlmittel und Kühlmittelzusätze können die
Umwelt verschmutzen. Ausgelaufenes Kühl-
mittel ist aufzuwischen und umweltgerecht zu
entsorgen. Motorkühlmittelstand prüfen und
Motorkühlmittel nachfüllen
Abb. 109
Im Motorraum: Markierung an dem
Motorkühlmittelausgleichsbehälter. Abb. 110
Im Motorraum: Deckel des Motor-
kühlmittelausgleichsbehälters. Wenn der Motorkühlmittelstand zu gering ist,
leuchtet die Warnleuchte des Motorkühlmit-
tels auf.
Vorbereitungen
● Fahrzeug auf einer waagerechten und fes-
ten Fläche parken.
● Motor abkühlen lassen ››› .
● Motorraumklappe öffnen ››› Seite 150 .
● Der Au
sgleichsbehälter des Motorkühlmit-
tels ist am Symbol auf dem Deckel erkenn-
bar ››› Abb. 110
.
Motorkühlmittelstand prüfen
● Motorkühlmittelstand bei kaltem Motor an
der seitlichen Markierung des Ausgleichsbe-
hälters prüfen ››› Abb. 109.
● Wenn der Flüs
sigkeitsstand im Behälter un-
terhalb der Minimal-Markierung „MIN“ liegt, Motorkühlmittel nachfüllen. Bei warmem Mo-
tor kann der Motorkühlmittelstand etwas
über der Oberkante des markierten Bereichs
stehen.
Motorkühlmittel nachfüllen
●
Immer das Gesicht, die Hände und Arme
vor heißem Motorkühlmittel oder Dampf
schützen, indem ein geeigneter Lappen auf
den Deckel des Ausgleichbehälters gelegt
wird.
● Den Deckel vorsichtig abschrauben ››› .
● Nur neues
Motorkühlmittel gemäß der SEAT
S
pezifikation ( ››› Seite 158) nachfüllen ››› .
● Der Motorkühlmittelstand muss sich inner-
halb der Markierungen des Ausgleichsbehäl-
ters befinden ››› Abb. 109 .
Nicht über die
O
berkante des markierten Bereichs auffüllen
››› !
● Den Deckel fest zuschrauben.
● Falls in einem Notfall kein Motorkühlmittel
gemäß der geforderten Spezifikation ( ››› Sei-
te 158 ) zur Verfügung steht, keinen anderen
Mot orküh
lmittelzusatz verwenden. Statt des-
sen zunächst nur destilliertes Wasser ››› auffüllen. Anschließend das richtige Mi-
schungsverhältnis mit dem vorgeschriebenen
Motorkühlmittelzusatz schnellstmöglich wie-
derherstellen lassen
›››
Seite 158 .
»
159
Technische Daten
Empfehlungen
Bedienung
Sicherheit
Page 167 of 229
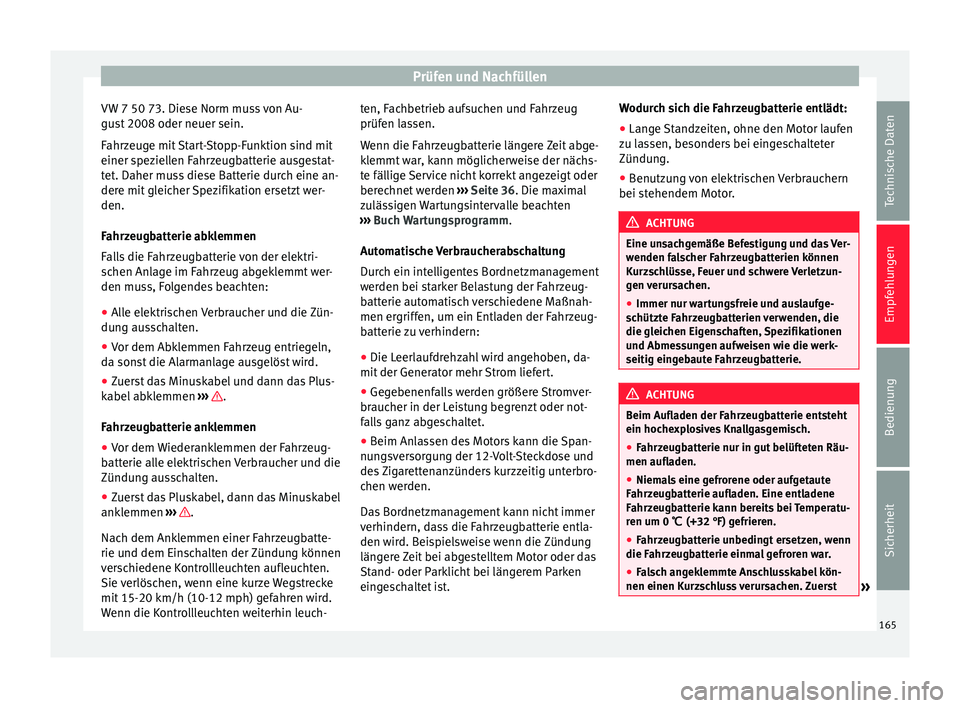
Prüfen und Nachfüllen
VW 7 50 73. Diese Norm muss von Au-
gust 2008 oder neuer sein.
Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion sind mit
einer speziellen Fahrzeugbatterie ausgestat-
tet. Daher muss diese Batterie durch eine an-
dere mit gleicher Spezifikation ersetzt wer-
den.
Fahrzeugbatterie abklemmen
Falls die Fahrzeugbatterie von der elektri-
schen Anlage im Fahrzeug abgeklemmt wer-
den muss, Folgendes beachten:
● Alle elektrischen Verbraucher und die Zün-
dung ausschalten.
● Vor dem Abklemmen Fahrzeug entriegeln,
da sonst die Alarmanlage ausgelöst wird.
● Zuerst das Minuskabel und dann das Plus-
kabel abklemmen ››› .
Fahrzeugbatterie anklemmen
● Vor dem Wiederanklemmen der Fahrzeug-
batterie alle elektrischen Verbraucher und die
Zündung ausschalten.
● Zuerst das Pluskabel, dann das Minuskabel
anklemmen ››› .
Nach dem Anklemmen einer Fahrzeugbatte-
rie und dem Einschalten der Zündung können
verschiedene Kontrollleuchten aufleuchten.
Sie verlöschen, wenn eine kurze Wegstrecke
mit 15-20 km/h (10-12 mph) gefahren wird.
Wenn die Kontrollleuchten weiterhin leuch- ten, Fachbetrieb aufsuchen und Fahrzeug
prüfen lassen.
Wenn die Fahrzeugbatterie längere Zeit abge-
klemmt war, kann möglicherweise der nächs-
te fällige Service nicht korrekt angezeigt oder
berechnet werden
››› Seite 36. Die maximal
zulässigen Wartungsintervalle beachten
››› Buch Wartungsprogramm .
Aut om
atische Verbraucherabschaltung
Durch ein intelligentes Bordnetzmanagement
werden bei starker Belastung der Fahrzeug-
batterie automatisch verschiedene Maßnah-
men ergriffen, um ein Entladen der Fahrzeug-
batterie zu verhindern:
● Die Leerlaufdrehzahl wird angehoben, da-
mit der Generator mehr Strom liefert.
● Gegebenenfalls werden größere Stromver-
braucher in der Leistung begrenzt oder not-
falls ganz abgeschaltet.
● Beim Anlassen des Motors kann die Span-
nungsversorgung der 12-Volt-Steckdose und
des Zigarettenanzünders kurzzeitig unterbro-
chen werden.
Das Bordnetzmanagement kann nicht immer
verhindern, dass die Fahrzeugbatterie entla-
den wird. Beispielsweise wenn die Zündung
längere Zeit bei abgestelltem Motor oder das
Stand- oder Parklicht bei längerem Parken
eingeschaltet ist. Wodurch sich die Fahrzeugbatterie entlädt:
●
Lange Standzeiten, ohne den Motor laufen
zu lassen, besonders bei eingeschalteter
Zündung.
● Benutzung von elektrischen Verbrauchern
bei stehendem Motor. ACHTUNG
Eine unsachgemäße Befestigung und das Ver-
wenden falscher Fahrzeugbatterien können
Kurzschlüsse, Feuer und schwere Verletzun-
gen verursachen.
● Immer nur wartungsfreie und auslaufge-
schützte Fahrzeugbatterien verwenden, die
die gleichen Eigenschaften, Spezifikationen
und Abmessungen aufweisen wie die werk-
seitig eingebaute Fahrzeugbatterie. ACHTUNG
Beim Aufladen der Fahrzeugbatterie entsteht
ein hochexplosives Knallgasgemisch.
● Fahrzeugbatterie nur in gut belüfteten Räu-
men aufladen.
● Niemals eine gefrorene oder aufgetaute
Fahrzeugbatterie aufladen. Eine entladene
Fahrzeugbatterie kann bereits bei Temperatu-
ren um 0 ℃ (+32 °F) gefrier
en.
● Fahrzeugbatterie unbedingt ersetzen, wenn
die Fahrzeugbatterie einmal gefroren war.
● Falsch angeklemmte Anschlusskabel kön-
nen einen Kurzschluss verursachen. Zuerst » 165
Technische Daten
Empfehlungen
Bedienung
Sicherheit
Page 173 of 229
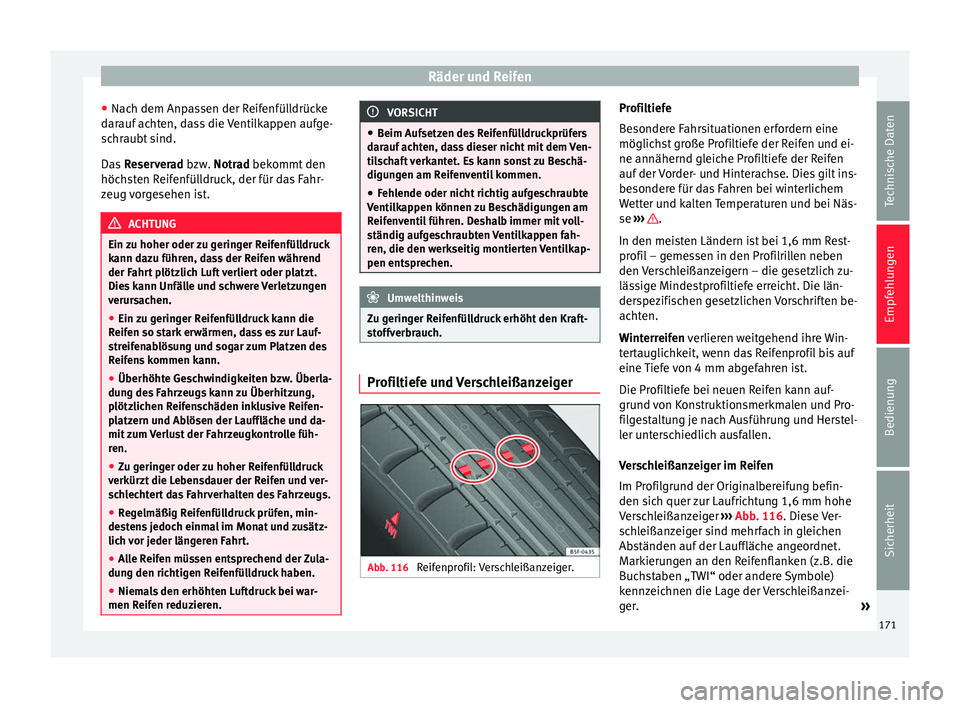
Räder und Reifen
● Nach dem Anpassen der Reifenfülldrücke
darauf achten, dass die Ventilkappen aufge-
schraubt sind.
Das Reserverad bzw.
Notrad bekommt den
höchsten Reifenfülldruck, der für das Fahr-
zeug vorgesehen ist. ACHTUNG
Ein zu hoher oder zu geringer Reifenfülldruck
kann dazu führen, dass der Reifen während
der Fahrt plötzlich Luft verliert oder platzt.
Dies kann Unfälle und schwere Verletzungen
verursachen.
● Ein zu geringer Reifenfülldruck kann die
Reifen so stark erwärmen, dass es zur Lauf-
streifenablösung und sogar zum Platzen des
Reifens kommen kann.
● Überhöhte Geschwindigkeiten bzw. Überla-
dung des Fahrzeugs kann zu Überhitzung,
plötzlichen Reifenschäden inklusive Reifen-
platzern und Ablösen der Lauffläche und da-
mit zum Verlust der Fahrzeugkontrolle füh-
ren.
● Zu geringer oder zu hoher Reifenfülldruck
verkürzt die Lebensdauer der Reifen und ver-
schlechtert das Fahrverhalten des Fahrzeugs.
● Regelmäßig Reifenfülldruck prüfen, min-
destens jedoch einmal im Monat und zusätz-
lich vor jeder längeren Fahrt.
● Alle Reifen müssen entsprechend der Zula-
dung den richtigen Reifenfülldruck haben.
● Niemals den erhöhten Luftdruck bei war-
men Reifen reduzieren. VORSICHT
● Beim Aufsetzen des Reifenfülldruckprüfers
darauf achten, dass dieser nicht mit dem Ven-
tilschaft verkantet. Es kann sonst zu Beschä-
digungen am Reifenventil kommen.
● Fehlende oder nicht richtig aufgeschraubte
Ventilkappen können zu Beschädigungen am
Reifenventil führen. Deshalb immer mit voll-
ständig aufgeschraubten Ventilkappen fah-
ren, die den werkseitig montierten Ventilkap-
pen entsprechen. Umwelthinweis
Zu geringer Reifenfülldruck erhöht den Kraft-
stoffverbrauch. Profiltiefe und Verschleißanzeiger
Abb. 116
Reifenprofil: Verschleißanzeiger. Profiltiefe
Besondere Fahrsituationen erfordern eine
möglichst große Profiltiefe der Reifen und ei-
ne annähernd gleiche Profiltiefe der Reifen
auf der Vorder- und Hinterachse. Dies gilt ins-
besondere für das Fahren bei winterlichem
Wetter und kalten Temperaturen und bei Näs-
se
››› .
In den meisten Ländern ist bei 1,6 mm Rest-
profil – gemessen in den Profilrillen neben
den Verschleißanzeigern – die gesetzlich zu-
lässige Mindestprofiltiefe erreicht. Die län-
derspezifischen gesetzlichen Vorschriften be-
achten.
Winterreifen verlieren weitgehend ihre Win-
t er
tauglichkeit, wenn das Reifenprofil bis auf
eine Tiefe von 4 mm abgefahren ist.
Die Profiltiefe bei neuen Reifen kann auf-
grund von Konstruktionsmerkmalen und Pro-
filgestaltung je nach Ausführung und Herstel-
ler unterschiedlich ausfallen.
Verschleißanzeiger im Reifen
Im Profilgrund der Originalbereifung befin-
den sich quer zur Laufrichtung 1,6 mm hohe
Verschleißanzeiger ››› Abb. 116
. Diese Ver-
schleißanzeiger sind mehrfach in gleichen
Abständen auf der Lauffläche angeordnet.
Markierungen an den Reifenflanken (z.B. die
Buchstaben „TWI“ oder andere Symbole)
kennzeichnen die Lage der Verschleißanzei-
ger. »
171
Technische Daten
Empfehlungen
Bedienung
Sicherheit
Page 181 of 229
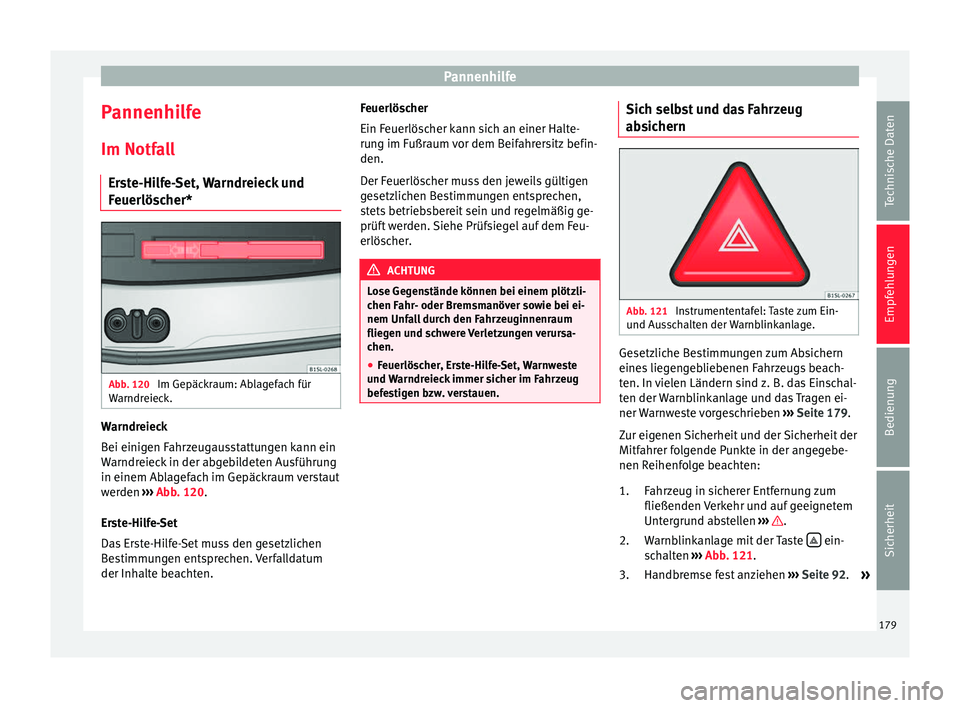
Pannenhilfe
Pannenhilfe
Im Notfall Erste-Hilfe-Set, Warndreieck und
Feuerlöscher* Abb. 120
Im Gepäckraum: Ablagefach für
Warndreieck. Warndreieck
Bei einigen Fahrzeugausstattungen kann ein
Warndreieck in der abgebildeten Ausführung
in einem Ablagefach im Gepäckraum verstaut
werden
››› Abb. 120 .
Er s
te-Hilfe-Set
Das Erste-Hilfe-Set muss den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechen. Verfalldatum
der Inhalte beachten. Feuerlöscher
Ein Feuerlöscher kann sich an einer Halte-
rung im Fußraum vor dem Beifahrersitz befin-
den.
Der Feuerlöscher muss den jeweils gültigen
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen,
stets betriebsbereit sein und regelmäßig ge-
prüft werden. Siehe Prüfsiegel auf dem Feu-
erlöscher.
ACHTUNG
Lose Gegenstände können bei einem plötzli-
chen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei ei-
nem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum
fliegen und schwere Verletzungen verursa-
chen.
● Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Set, Warnweste
und Warndreieck immer sicher im Fahrzeug
befestigen bzw. verstauen. Sich selbst und das Fahrzeug
absichern
Abb. 121
Instrumententafel: Taste zum Ein-
und Ausschalten der Warnblinkanlage. Gesetzliche Bestimmungen zum Absichern
eines liegengebliebenen Fahrzeugs beach-
ten. In vielen Ländern sind z. B. das Einschal-
ten der Warnblinkanlage und das Tragen ei-
ner Warnweste vorgeschrieben
››› Seite 179.
Zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit der
Mitfahrer folgende Punkte in der angegebe-
nen Reihenfolge beachten:
Fahrzeug in sicherer Entfernung zum
fließenden Verkehr und auf geeignetem
Untergrund abstellen ››› .
Warnblinkanlage mit der Taste ein-
schalten ››› Abb. 121.
Handbremse fest anziehen ››› Seite 92 .
»
1.
2.
3.
179
Technische Daten
Empfehlungen
Bedienung
Sicherheit
Page 182 of 229
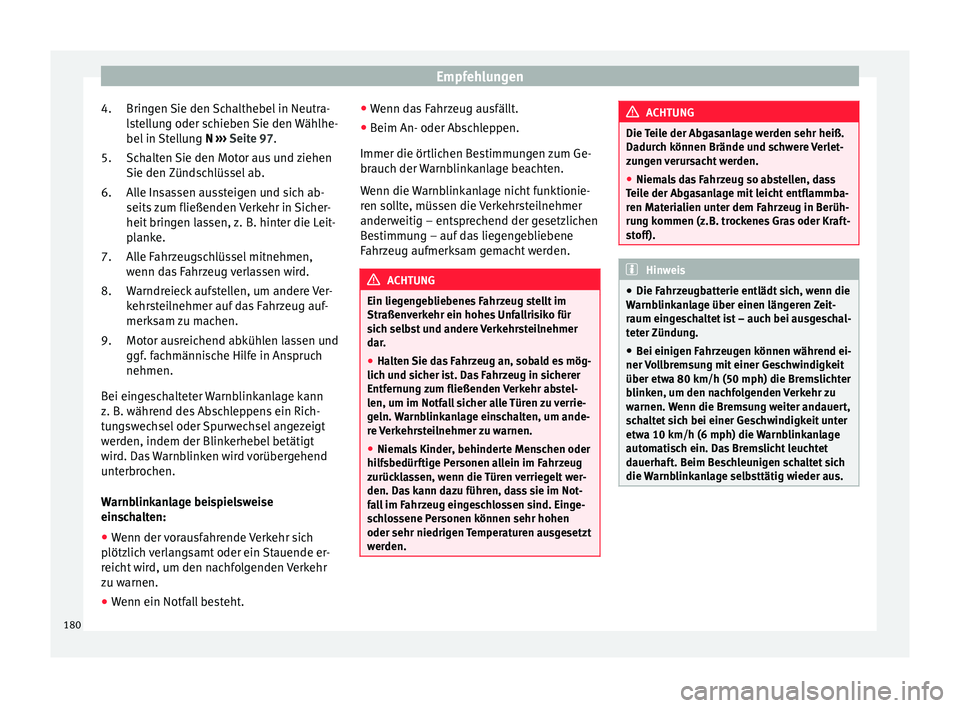
Empfehlungen
Bringen Sie den Schalthebel in Neutra-
lstellung oder schieben Sie den Wählhe-
bel in Stellung N
›
›› Seite 97.
Schalten Sie den Motor aus und ziehen
Sie den Zündschlüssel ab.
Alle Insassen aussteigen und sich ab-
seits zum fließenden Verkehr in Sicher-
heit bringen lassen, z. B. hinter die Leit-
planke.
Alle Fahrzeugschlüssel mitnehmen,
wenn das Fahrzeug verlassen wird.
Warndreieck aufstellen, um andere Ver-
kehrsteilnehmer auf das Fahrzeug auf-
merksam zu machen.
Motor ausreichend abkühlen lassen und
ggf. fachmännische Hilfe in Anspruch
nehmen.
Bei eingeschalteter Warnblinkanlage kann
z. B. während des Abschleppens ein Rich-
tungswechsel oder Spurwechsel angezeigt
werden, indem der Blinkerhebel betätigt
wird. Das Warnblinken wird vorübergehend
unterbrochen.
Warnblinkanlage beispielsweise
einschalten:
● Wenn der vorausfahrende Verkehr sich
plötzlich verlangsamt oder ein Stauende er-
reicht wird, um den nachfolgenden Verkehr
zu warnen.
● Wenn ein Notfall besteht.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
●
Wenn das Fahrzeug ausfällt.
● Beim An- oder Abschleppen.
Immer die örtlichen Bestimmungen zum Ge-
brauch der Warnblinkanlage beachten.
Wenn die Warnblinkanlage nicht funktionie-
ren sollte, müssen die Verkehrsteilnehmer
anderweitig – entsprechend der gesetzlichen
Bestimmung – auf das liegengebliebene
Fahrzeug aufmerksam gemacht werden. ACHTUNG
Ein liegengebliebenes Fahrzeug stellt im
Straßenverkehr ein hohes Unfallrisiko für
sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer
dar.
● Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es mög-
lich und sicher ist. Das Fahrzeug in sicherer
Entfernung zum fließenden Verkehr abstel-
len, um im Notfall sicher alle Türen zu verrie-
geln. Warnblinkanlage einschalten, um ande-
re Verkehrsteilnehmer zu warnen.
● Niemals Kinder, behinderte Menschen oder
hilfsbedürftige Personen allein im Fahrzeug
zurücklassen, wenn die Türen verriegelt wer-
den. Das kann dazu führen, dass sie im Not-
fall im Fahrzeug eingeschlossen sind. Einge-
schlossene Personen können sehr hohen
oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt
werden. ACHTUNG
Die Teile der Abgasanlage werden sehr heiß.
Dadurch können Brände und schwere Verlet-
zungen verursacht werden.
● Niemals das Fahrzeug so abstellen, dass
Teile der Abgasanlage mit leicht entflammba-
ren Materialien unter dem Fahrzeug in Berüh-
rung kommen (z.B. trockenes Gras oder Kraft-
stoff). Hinweis
● Die Fahrzeugbatterie entlädt sich, wenn die
Warnblinkanlage über einen längeren Zeit-
raum eingeschaltet ist – auch bei ausgeschal-
teter Zündung.
● Bei einigen Fahrzeugen können während ei-
ner Vollbremsung mit einer Geschwindigkeit
über etwa 80 km/h (50 mph) die Bremslichter
blinken, um den nachfolgenden Verkehr zu
warnen. Wenn die Bremsung weiter andauert,
schaltet sich bei einer Geschwindigkeit unter
etwa 10 km/h (6 mph) die Warnblinkanlage
automatisch ein. Das Bremslicht leuchtet
dauerhaft. Beim Beschleunigen schaltet sich
die Warnblinkanlage selbsttätig wieder aus. 180